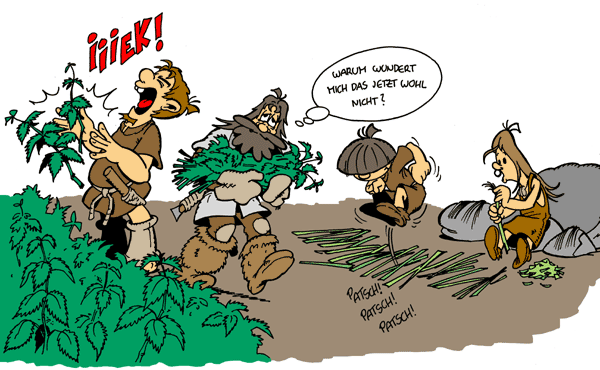DIE GEWINNUNG VON FASERN
Fäden, Schnüre und sogar Seile gewannen die Menschen der Steinzeit sowohl aus pflanzlichen als auch
tierischen Fasern. Diese wurden zu einzelnen Garnen zusammengedreht, von denen zwei oder drei miteinander verzwirnt
wurden. So waren die Kleidungsstücke des Gletschermannes mit Fäden aus Tiersehnen vernäht, während
er spätere Reparaturen an der Kleidung mit Fäden aus Gräsern vornahm. Zudem befanden sich fertige
Grasschnüre und Tiersehnen im Rohzustand in Ötzls Gepäck. Das längste dieser Schnurstücke
mißt 87 Zentimeter; diese Schnur muß allerdings noch länger gewesen sein, weil beide Enden abgerissen
waren.
Pflanzliche Fasern lieferten den Menschen u.a. Baumbast, Flachs, das in der Jungsteinzeit
bereits als Nutzpflanze landwirtschaftlich angebaut wurde, Hanf und Nesseln. Überreste von Nesseln
fand man z.B. in der Nähe der Schweizer Pfahlbauten (ca. 3000 v. Chr.). Baumbast konnte ebenfalls zu Schnüren
verarbeitet werden.
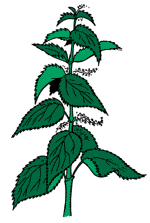 Die in den gemäßigten Breiten
heimische Große Brennessel (Urtica dioica) dürfte für die Gewinnung von pflanzlichen
Fasern eine große Rolle gespielt haben. Zum einen besiedelte diese anspruchslose Pflanze die meist stickstoffreichen
Böden in der Nähe menschlicher Wohnstätten sowie die Ufer von Flußläufen, zum anderen
besaß sie im Gegensatz zu den Einjahrespflanzen Hanf und Flachs bzw. der einjährigen, bis zu 60 cm hohen
Kleinen Brennessel (Urtica urens) eine Lebensdauer von bis zu 12 Jahren.
Die in den gemäßigten Breiten
heimische Große Brennessel (Urtica dioica) dürfte für die Gewinnung von pflanzlichen
Fasern eine große Rolle gespielt haben. Zum einen besiedelte diese anspruchslose Pflanze die meist stickstoffreichen
Böden in der Nähe menschlicher Wohnstätten sowie die Ufer von Flußläufen, zum anderen
besaß sie im Gegensatz zu den Einjahrespflanzen Hanf und Flachs bzw. der einjährigen, bis zu 60 cm hohen
Kleinen Brennessel (Urtica urens) eine Lebensdauer von bis zu 12 Jahren.
Sie ist im Laufe der Geschichte wiederholt vom Menschen zu verschiedenen Zwecken verwendet worden (Heilpflanze,
Gemüse und Futtermittel), wobei die Fasernutzung aber meist im Vordergrund stand.
Die Große Brennessel wird zwischen 30 und 150 cm hoh und besitzt einen vierkantigen, holzigen Stengel
sowie graugrüne, herzförmige und am Rand grobgesägte Blätter. Sowohl Stengel als auch Blätter
sind mit feinen Brennhaaren besetzt, deren feine Spitzen bei Berührung abbrechen und Ameisensäure freisetzen,
die brennende Schmerzen erzeugt.
 Die bis zu 5 cm langen, sehr starken Fasern
der Brennesseln sind vor allem in der Rinde des Stengels, zwischen der sogenannten Oberhaut und dem Holzkörper
im Inneren, zu finden.
Die bis zu 5 cm langen, sehr starken Fasern
der Brennesseln sind vor allem in der Rinde des Stengels, zwischen der sogenannten Oberhaut und dem Holzkörper
im Inneren, zu finden.
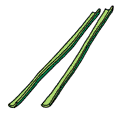 Zur Gewinnung der Fasern entfernt man
zunächst die Blätter, anschließend schabt man die Oberhaut der Stengel mit einer scharfen Klinge
ab. Nachdem die Stengel ein paar Tage getrocknet wurden, legt man sie auf einen flachen Boden und tritt sie flach,
damit sie der Länge nach auseinanderbrechen.
Zur Gewinnung der Fasern entfernt man
zunächst die Blätter, anschließend schabt man die Oberhaut der Stengel mit einer scharfen Klinge
ab. Nachdem die Stengel ein paar Tage getrocknet wurden, legt man sie auf einen flachen Boden und tritt sie flach,
damit sie der Länge nach auseinanderbrechen.
Diese länglichen Streifen nimmt man so in die Hand, daß sie wenige Zentimeter über die Hand
hinausragen und ihre Innenseite nach vorne schaut. Der holzige Teil wird vorsichtig nach außen gebrochen,
ohne dabei die Rinde zu beschädigen. Das abgebrochene holzige Stück wird nach oben abgezogen, anschließend
kann man die freigelegten Fasern ein Stück nach unten ziehen. Danach wiederholt man diese Arbeitsschritte,
bis alle Fasern freiliegen.

 Tierische Fasern konnten aus
Wolle und Haaren sowie aus getrockneten Gedärmen und Sehnen von Tieren gewonnen werden. Wolle hat gegenüber
den Haaren den Vorteil, daß sie weicher und feiner ist und sich die Wollfasern auf Grund ihres Aufbaus besser
ineinander verhängen. Haare müssen erst mit Harz behandelt werden, damit sie sich besser verbinden und
nicht mehr auseinanderfallen.
Tierische Fasern konnten aus
Wolle und Haaren sowie aus getrockneten Gedärmen und Sehnen von Tieren gewonnen werden. Wolle hat gegenüber
den Haaren den Vorteil, daß sie weicher und feiner ist und sich die Wollfasern auf Grund ihres Aufbaus besser
ineinander verhängen. Haare müssen erst mit Harz behandelt werden, damit sie sich besser verbinden und
nicht mehr auseinanderfallen.
Zu Ötzls Zeit waren die wohl gebräuchlichsten tierischen Fasern jene aus Tiersehnen. Die längsten
Fasern findet man in der Achillessehne und am Rücken des Tieres.
Zerlegt man die Sehne im frischen Zustand in Fäden, können diese sofort verwendet werden. Hat man
die Sehne selbst, z.B. aus Gründen der Aufbewahrung, getrocknet, muß sie mit einem Holzstück oder
einem flachen Stein vorsichtig zerklopft werden, damit sich die Fasern aus dem Faserverbund der Sehne lösen
können.
Diese tierischen und pflanzlichen Fasern können nun zu Garnen, Fäden usw.
weiterverarbeitet werden. Als ersten Schritt sollte man noch die Fasern zwischen Daumen und Zeigefinger reiben.
Dadurch können nicht nur Reste von Verbundstoffen entfernt werden, die Fasern selbst werden weicher und flexibler
und ihre Oberflächen rauhen etwas auf, sodaß die Fasern besser ineinander greifen.
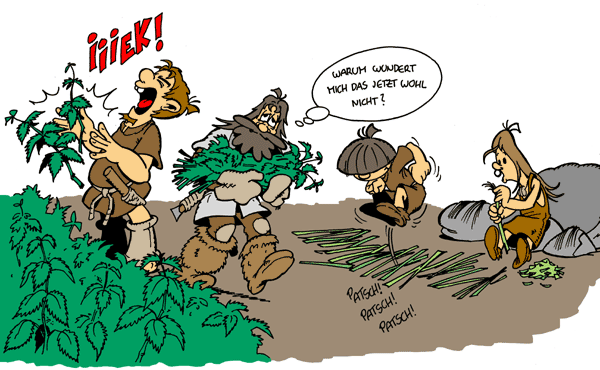
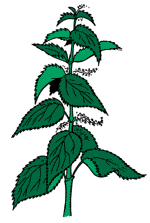 Die in den gemäßigten Breiten
heimische Große Brennessel (Urtica dioica) dürfte für die Gewinnung von pflanzlichen
Fasern eine große Rolle gespielt haben. Zum einen besiedelte diese anspruchslose Pflanze die meist stickstoffreichen
Böden in der Nähe menschlicher Wohnstätten sowie die Ufer von Flußläufen, zum anderen
besaß sie im Gegensatz zu den Einjahrespflanzen Hanf und Flachs bzw. der einjährigen, bis zu 60 cm hohen
Kleinen Brennessel (Urtica urens) eine Lebensdauer von bis zu 12 Jahren.
Die in den gemäßigten Breiten
heimische Große Brennessel (Urtica dioica) dürfte für die Gewinnung von pflanzlichen
Fasern eine große Rolle gespielt haben. Zum einen besiedelte diese anspruchslose Pflanze die meist stickstoffreichen
Böden in der Nähe menschlicher Wohnstätten sowie die Ufer von Flußläufen, zum anderen
besaß sie im Gegensatz zu den Einjahrespflanzen Hanf und Flachs bzw. der einjährigen, bis zu 60 cm hohen
Kleinen Brennessel (Urtica urens) eine Lebensdauer von bis zu 12 Jahren. Die bis zu 5 cm langen, sehr starken Fasern
der Brennesseln sind vor allem in der Rinde des Stengels, zwischen der sogenannten Oberhaut und dem Holzkörper
im Inneren, zu finden.
Die bis zu 5 cm langen, sehr starken Fasern
der Brennesseln sind vor allem in der Rinde des Stengels, zwischen der sogenannten Oberhaut und dem Holzkörper
im Inneren, zu finden.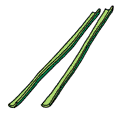 Zur Gewinnung der Fasern entfernt man
zunächst die Blätter, anschließend schabt man die Oberhaut der Stengel mit einer scharfen Klinge
ab. Nachdem die Stengel ein paar Tage getrocknet wurden, legt man sie auf einen flachen Boden und tritt sie flach,
damit sie der Länge nach auseinanderbrechen.
Zur Gewinnung der Fasern entfernt man
zunächst die Blätter, anschließend schabt man die Oberhaut der Stengel mit einer scharfen Klinge
ab. Nachdem die Stengel ein paar Tage getrocknet wurden, legt man sie auf einen flachen Boden und tritt sie flach,
damit sie der Länge nach auseinanderbrechen.
 Tierische Fasern konnten aus
Wolle und Haaren sowie aus getrockneten Gedärmen und Sehnen von Tieren gewonnen werden. Wolle hat gegenüber
den Haaren den Vorteil, daß sie weicher und feiner ist und sich die Wollfasern auf Grund ihres Aufbaus besser
ineinander verhängen. Haare müssen erst mit Harz behandelt werden, damit sie sich besser verbinden und
nicht mehr auseinanderfallen.
Tierische Fasern konnten aus
Wolle und Haaren sowie aus getrockneten Gedärmen und Sehnen von Tieren gewonnen werden. Wolle hat gegenüber
den Haaren den Vorteil, daß sie weicher und feiner ist und sich die Wollfasern auf Grund ihres Aufbaus besser
ineinander verhängen. Haare müssen erst mit Harz behandelt werden, damit sie sich besser verbinden und
nicht mehr auseinanderfallen.